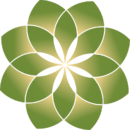Das menschliche Nervensystem ist ein Wunderwerk der Natur. Damit wir seine besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften optimal für uns nutzen können, ist es hilfreich, über seine Funktionsweise Bescheid zu wissen. Ein Forscher, der in den letzten Jahren entscheidend zum Verständnis unseres Nervensystems beigetragen hat, ist Stephen Porges mit seiner Polyvagaltheorie. Porges erforschte, welche Bedingungen heranwachsende Säugetiere und Menschen brauchen, um sich optimal entwickeln zu können.
Da Menschen wie auch die Säugetiere hilflos auf die Welt kommen, sind sie auf den Schutz und die Fürsorge ihrer Bezugspersonen angewiesen. Das Zauberwort dabei ist Bindung. Bindung beschreibt das angeborene Bedürfnis von Menschen, eine enge Gefühlsbeziehung zu den Bezugspersonen aufzubauen. Sie entsteht durch Blickkontakt, Berührungen, Lächeln, liebevolle Worte, etc. – alles, was Eltern normalerweise ganz intuitiv mit ihren Babys tun. Das macht Sinn, denn dadurch entsteht ein beidseitiges inniges Zugehörigkeitsgefühl. Es bewirkt, dass sich das Kind bei Gefahr an die Bezugsperson klammert und diese umgekehrt alles tut, um das Kind zu schützen. Das Kind ist somit in seinem Bedürfnis nach Sicherheit darauf angewiesen, dass es eine Bindung zu einer engen Bezugsperson gibt.
Ein sehr grausames Experiment mit Bindung wird Kaiser Friedrich II. aus dem 13. Jahrhundert zugeschrieben. Über die Details dieses Experiments ist wenig bekannt, nur soviel, dass Friedrich wissen wollte, in welcher Sprache ein Kind von selbst zu sprechen beginnt, wenn ihm durch die Umgebung keine Sprache vorgegeben wird. Er wies die Ammen von neugeborenen Babys an, diese zwar mit Nahrung zu versorgen, aber jegliche Ansprache zu unterlassen. Die bedauernswerten Kinder starben alle. Friedrich schrieb dazu: „Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen.“ Ob das Experiment tatsächlich so stattgefunden hat, weiß man nicht. Die Geschichte illustriert aber gut, dass den Menschen die Wichtigkeit von Bindung sehr wohl bewusst war.
Was hat dies nun mit unserem Nervensystem zu tun? Porges hält fest, dass wir nur dann in der Lage sind, eine funktionierende Bindung aufzubauen, wenn wir uns sicher fühlen. Wer auf der Flucht vor einem Säbelzahntiger ist, hat keine Zeit, sich um Bindung zu kümmern, weil es wahrlich Wichtigeres zu tun gibt. Unser Nervensystem hat sich daher auf alle Situationen, denen Menschen ausgesetzt sein können, optimal eingestellt. Porges unterscheidet dabei drei Zustände des Nervensystems. Der erste Zustand macht uns optimal wachsam und ermöglicht uns, Gefahren zu bewältigen. Dieser Zustand wurde in der Frühzeit der Menschheit zum Beispiel dann eingeschaltet, wenn wir einem Säbelzahntiger begegneten. Heute wird er vielleicht eingeschaltet, wenn wir einen Vortrag halten müssen oder mit dem Auto in schwierigem Gelände unterwegs sind, oder wenn ein Chirurg hochkonzentriert eine Operation durchführt.
Natürlich gab es in der Menschheitsgeschichte auch immer wieder Situationen, die unbewältigbar waren und denen der Mensch vollkommen ausgeliefert war. So ein Fall trat zum Beispiel dann ein, wenn die Flucht vor dem Säbelzahntiger nicht gelang und sich der Mensch letztendlich dem Tod gegenübersah. Auch für diesen Fall hat unser Nervensystem vorgesorgt. Es schaltet in den zweiten Zustand, einen Zustand der Erstarrung, wo unser Bewusstsein von der Situation abgekoppelt wird und unser Gehirn schmerzstillenden Stoffe ausschüttet, die die Situation möglichst erträglich machen sollen. Heutzutage kann unser Nervensystem zum Beispiel in diesen Zustand kippen, wenn uns jemand körperlich bedroht. Es bleibt einem quasi das Herz stehen und die Verdauung spielt verrückt. Es muss aber nicht unbedingt eine lebensbedrohliche Situation vorliegen, dass unser Nervensystem so reagiert. Es kann auch schon ausreichen, wenn einen der Chef verbal zur Schnecke macht. Da steht man da und weiß vielleicht nicht, wie einem geschieht. Man möchte etwas zu seiner Verteidigung sagen, aber kann nicht. Man ist wie erstarrt und die Stimme eingefroren…
Wenn so eine Situation zu Ende ist, schaltet unser Nervensystem idealerweise wieder in seinen entspannten Normalzustand zurück, den dritten Zustand nach Porges. Und nur in diesem dritten Zustand sind wir in der Lage, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten und Bindung herzustellen!
Nun wird klarer, was dies für die Entwicklung von Kindern bedeutet, die mit dauergestressten Eltern aufwachsen müssen. Stress bedeutet, übersetzt in die Sprache unseres Nervensystems, dass wir uns im ersten oder zweiten der oben beschriebenen Zustände befinden, die es uns unmöglich machen, auf andere Menschen einzugehen und Bindung herzustellen. Es ist in der Natur eines Kindes, dass es ständig versucht, Bindung zu bekommen. Wenn nun die Bindungsangebote des Kindes von gestressten Eltern nicht wahrgenommen werden können, dann beginnt eine traurige Entwicklung. Das Kind bezieht die Ablehnung des Bindungsangebots auf sich selbst. Es schließt daraus, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Es gibt sich selbst die Schuld und meint, dass es eben nicht liebenswert ist. All die fehlende Selbstliebe, die in unserer Gesellschaft so verbreitet ist, hat hier ihren Ursprung. Wenn hier keine Heilungsarbeit gemacht wird, setzt sich der Teufelskreis fort. Unzureichend gebundene Kinder werden erwachsen und selbst zu Eltern, während sie all den alten Stress aus ihrer Kindheit immer noch in sich tragen und daher nicht angemessen auf die Bindungsangebote ihrer eigenen Kinder reagieren können.
Was es braucht, ist eine Auflösung des alten Stresses, damit dieser nicht mehr weitergegeben wird, und Kinder echte Bindung als Grundlage für eine gesunde Selbstliebe erfahren können.
Wie diese Heilungsarbeit geschehen könnte und welchen Beitrag die Traumasensitive Kinesiologie dazu leisten kann, erfahren Sie in einem meiner nächsten Posts.